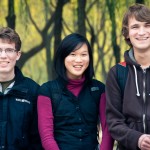-
Neueste Beiträge
Archiv
Links
Geschützt: November 2014
Veröffentlicht unter Allgemein Kommentare deaktiviert für Geschützt: November 2014
Auf zu neuen Grenzen
Ein Reiseblog – so muss man diese zugegebenermaßen wenig umfangreiche Ansammlung von Berichten wohl ehrlicherweise nennen. Um wenigstens diesem Anspruch zu genügen, möchte ich auch von der letzten und längsten Reise nach Xinjiang, die westlichste Provinz Chinas, erzählen.
Auf unsere Ankunft in einer kaum auszuhaltenden Hitze folgte zunächst die Ernüchterung für Jingyi, Philipp, Jan Luis und mich: Statt exotischer Basare in Oasenstädten entlang der Seidenstraße hieß uns Ürümqi, die Provinzhauptstadt, mit dem uniformen und von Beton dominierten Stadtbild so vieler chinesischer Städte willkommen. Aufgrund großer Erdölvorkommen durchlebt die Stadt einen rasanten wirtschaftlichen Bedeutungszuwachs und lockt, dank Prämien von der chinesischen Regierung, viele Han-Chinesen an. Deren Zahl ist mittlerweile so groß, dass einige aus der hier traditionell ansässigen Volksgruppe der Uiguren gegen die drohende kulturelle Marginalisierung gewaltsam protestiert haben. Noch während unserer Reise sollten nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur drei Aufständische den Tod finden.
Kehrt man Ürümqi den Rücken und durchquert das karge Land, so wird vor allem dessen Aridität deutlich. Tatsächlich ist dies der Ort der Erde, der am weitesten von einem Meer oder Ozean entfernt ist und so versinkt Turpan, unsere nächste Station, schon mal in einer dichten Staubwolke. Dass dennoch ein Großteil des chinesischen Obsts und Gemüses in dieser Region produziert wird, ist einem ausgeklügelten Bewässerungssystem zu verdanken, das Schmelzwasser aus den nördlichen Gebirgen durch von Menschenhand angelegte Tunnel transportiert und Verdunstungsverluste auf diese Weise minimiert. Und so bersten die Straßenstände schier vor diversen Melonenarten und ergänzen damit den Speiseplan, auf dem vorwiegend Hammelfleisch zu stehen scheint. Schon vor tausenden von Jahren siedelten Menschen in diesem fruchtbaren Landstrich, wie eine zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Ruinenstadt nahelegt. Genauso wie die Höhlenmalereien in den Feuerbergen war sie buddhistisch geprägt, ehe der Islam Einzug in das Land hielt.
Wirklich einprägsam ist eine Reise erst, wenn auch die Fortbewegung zum Erlebnis wird. Zusammen mit einer großen Gruppe Einheimischer und Wanderarbeiter bestiegen wir also einen doppelstöckigen Schlafbus, der uns in 25 Stunden nach Kashgar im Südwesten bringen sollte. Kaum hatten wir es uns in den eineinhalb Meter langen Betten und den Eierschalen unserer Vorgänger bequem gemacht, da verbreitete sich ein unangenehm penetranter Geruchscocktail aus Knoblauch und Käsefüßen – zusammen mit der unzuverlässigen Klimaanlage und den direkt über uns schallenden arabischen Rhythmen geradezu ein Schrei nach Vergeltung. Die rohen Knoblauchzehen, mit denen wir nach dem Frühstück unseren Mitfahrern Paroli bieten wollten, ließen diese jedoch gänzlich unbeeindruckt.
Kashgar immerhin entschädigte für vieles. Wenig erinnert hier noch an die Volksrepublik: Auf den Straßenschildern dominiert arabische Schrift und statt Reis zählen Nudeln und Brot zu den Grundnahrungsmitteln; auf den unübersichtlichen Basaren bieten verschleierte Frauen ihre Waren feil. Immer wieder kehrten wir zwischen unseren Ausflügen an diesen Ort zurück, wo der Kaffee und der Joghurt im Restaurant „Mammut“ sowie stundenlanges Kartenspielen in einem verfallenen Teehaus unvergesslich sind. Ebenfalls in Erinnerung bleiben wird uns der durchdringende Gestank nach Urin in der Eingangshalle des Krankenhauses, in dem wir den Arzt Kahar trafen. Als entfernter Bekannter von Philipps amerikanischem Lehrerkollegen half uns dieser, einen Kameltrip in die Taklamakan-Wüste zu planen, sodass wir zwei Tage später mit einem Kameltreiber unsere schaukelnden Reittiere auf meterhohen Dünen navigierten. Von der windgeschützten Warte unseres Nachtlagers aus genossen wir – zum ersten Mal in China – den Sternenhimmel und absolute Stille.
Eine gänzlich andere Szenerie bot sich uns auf dem zweiten Ausflug entlang des Highways Richtung Pakistan. In 3500 Metern Höhe liegt, umringt von schneebedeckten Gipfeln, der Karakul-See. Nachdem wir die Nacht unter je sieben schweren Decken in einer Jurte verbracht hatten und wider Erwarten kein Bus kam, ließen wir uns von einem Angehörigen der dortigen ethnischen Minderheit auf Motorrädern zu seiner Behausung verfrachten, wo wir uns an einer Schüssel mit frischem Milchtee aus Yak-Milch die Hände wärmten. Zum Essen gesellten sich weitere Familienmitglieder hinzu, mit denen wir ein Reisgericht und den ebenfalls aus Yak-Milch zubereiteten Joghurt teilten.
Als Anhalter ergatterten wir Plätze in einem vorbeifahrenden Bus, der uns in die letzte Stadt vor der Grenze zu Pakistan brachte. Hier aber wurden wir mit einer absurden Situation konfrontiert: Keines der zahlreichen Hotels besaß die Zulassung, um ausländische Gäste aufnehmen zu dürfen; abgewiesen wurden wir jedoch stets mit dem Hinweis, es sei kein Zimmer mehr zu vergeben. Da es nicht einmal Parkbänke gab, auf denen man die Nacht hätte verbringen können, traten wir mit einem inoffiziell als Taxifahrer operierenden Privatmann und zwei Chinesen die Rückkehr an. Froh, den chaotischen Tag mit einer ruhigen Fahrt beenden zu können, entspannten wir uns in den Sitzen. Doch wie sich herausstellte, war die Fahrt so ruhig nicht.
Trotz seines sportlichen Fahrstils kramte der Fahrer ein größeres Paket hervor und wählte die darauf notierte Handynummer. Offenbar kam es zu einer Vereinbarung, denn kurz darauf wendete er abrupt und hielt am ausgemachten Straßenschild. Während wir Insassen mutmaßten, es handele sich möglicherweise um Plutonium aus dem Nachbarland, näherte sich ein unbeleuchtetes Fahrzeug aus dem unwegsamen Gelände abseits der verlassenen Straße. Ungeduldig stieg unser Fahrer aus, um mit dem Neuankömmling zu verhandeln, jedoch ohne Erfolg. Über den Preis war man sich uneins, sodass es nicht zu einer Paketübergabe kam und der inzwischen ärgerlich gewordene Fahrer wieder aufs Gaspedal drückte. Unser Schmunzeln ob dieser Situationskomik entgleiste nur wenig später, als ein massiger Schemen (ein Kamel!) im Lichtkegel der Scheinwerfer erschien und wir einer Kollision nur um Haaresbreite entgingen. Mangelte es unserem Fahrer an Sehkraft? Offenbar nicht, zumindest erspähte er zwei einsame Wanderarbeiter in der stockfinsteren Nacht und stoppte neben ihnen. Zum Glück für uns gab es auch dieses Mal Uneinigkeit in der Preisfrage und so musste der ohnehin voll beladene Geländewagen nicht noch zwei weitere Passagiere aufnehmen. Fast hätten wir alle Hoffnung aufgegeben, doch um drei Uhr morgens erreichten wir unser Ziel. Hier allerdings wiederholte sich unerklärlicherweise die Serie von Absagen an den Hotels, sodass wir erst zwei Stunden später in einem überteuerten Zimmer zur Ruhe kamen.
Da wir für unseren Rückflug nach Ürümqi zurückkehren mussten, kontaktierten wir über Philipps weites Beziehungsnetzwerk einen weiteren Arzt in der Stadt, der uns allerdings „nur“ seinen Assistenten Jason schicken konnte. Obwohl es uns an jeglicher persönlicher Verbindung zu ihm mangelte, bot er sich an, uns den uigurischen Stadtteil zu zeigen und fachsimpelte mit uns bei einem köstlichen Essen (das er bezahlte) über die deutsche und die italienische Fußball-Liga. Bei einer Schale „Crazy Iced Joghurt“ gelang es ihm, uns auch mit dieser Stadt zu versöhnen – wenngleich unser schlechtes Gewissen angesichts einer solchen Gastfreundschaft ins Unermessliche wuchs.
- Philipps Snack
- Spieße
- Fleischer
- Nan
- Joghurt-Drink
- Melonenhändler
- Mittagessen
- Übernachtung in Jurte
- Karakul-See
- Kamel
- Sonnenuntergang in der Wüste
- Sonnenuntergang in der Wüste
- Kameltreiber
- Taklamakan-Wüste
- Kamelritt
- Weintrauben-Decke
- En garde!
- Teehaus
- Teehaus
- Kahar im Krankenhaus
- Gucci-Fußmatte
- Spielende Kinder
- Fußball-Nachwuchs
- Tor
- Verkäuferin
- Trockenobst & Nüsse
- Schlafbus
- Buddhistischer Höhlen-Schmuck
- Unser Fahrer
- Moschee
- Kleiner Mechaniker
- Homestay
- Eselskarren
- Wüstensand – und die Frisur sitzt
- Ruinenstadt
- Ruinenstadt
- Ruinenstadt
Veröffentlicht unter Allgemein Kommentare deaktiviert für Auf zu neuen Grenzen
Hongkong – Liebe auf den zweiten Blick
 Sieben Millionen Einwohner zwängen sich in das bergige Relief der 262 Inseln Hongkongs und sind dabei der Gefahr von Taifunen und dem tropisch-feuchten Wetter des Südchinesischen Meeres an mindestens zehn Monaten im Jahr ausgeliefert. Was den sozialistischen Planern der Volksrepublik Chinas wohl niemals in den Sinn gekommen wäre, machte die im Süden angrenzende, ehemals britische Kronkolonie zu einem der wichtigsten Finanzzentren Asiens und sichert ihr den heutigen Status als Sonderverwaltungszone mit eigenständiger Währung, weitgehender Pressefreiheit und Englisch als offizielle Amtssprache.
Sieben Millionen Einwohner zwängen sich in das bergige Relief der 262 Inseln Hongkongs und sind dabei der Gefahr von Taifunen und dem tropisch-feuchten Wetter des Südchinesischen Meeres an mindestens zehn Monaten im Jahr ausgeliefert. Was den sozialistischen Planern der Volksrepublik Chinas wohl niemals in den Sinn gekommen wäre, machte die im Süden angrenzende, ehemals britische Kronkolonie zu einem der wichtigsten Finanzzentren Asiens und sichert ihr den heutigen Status als Sonderverwaltungszone mit eigenständiger Währung, weitgehender Pressefreiheit und Englisch als offizielle Amtssprache.
Nur kurze Zeit nach der Landung im dichten weißen Smog, der von den nahen chinesischen Produktionsstandorten Shenzhen und Guangzhou herüberzieht, wird man gewahr, dass Hongkong trotz seiner Assimilation durch den großen Nachbarn seine Eigenständigkeit bewahrt hat. Die ungewohnte Querbeschleunigung im Doppeldecker-Bus, der auf der linken Straßenseite einen Kreisverkehr durchfährt, und die lateinische Umschrift der Ortsnamen im kantonesischen Stakkato erinnern vielmehr an ausgeprägte britische Einflüsse – wie im Übrigen auch die Ansammlung indischer Verkäufer vor unserer Herberge, die den geneigten Besucher mit den Worten „Hello, my friend. You need copy watch, tailored suit, apartment?“ begrüßen und ihm zum Abschied ein zischendes „Haschisch…“ als scheinbar größte Versuchung zuraunen. Dieses Klein-Mumbai befindet sich in einem der wenigen verbliebenen, eher unansehnlichen Relikten eines Wohnraum-Programms aus den 1970er Jahren und bietet nicht nur zahlreichen Geschäften, die einer Gewerbeprüfung wohl nicht standhalten würden, sondern auch Hostels mit wohlklingenden Namen wie „Four Seasons Guesthouse“, „Super Guesthouse“ oder „Pay Less Guesthouse“ Unterschlupf. Quälend langsame Fahrstühle wecken unwillkürlich Gedanken an so absurde Dinge wie Brandschutzvorkehrungen und bringen uns zur Rezeption, wo wir unter dem finsteren Blick turbantragender Religionsstifter unser Quartier beziehen.
Glücklicherweise trüben solche Betonbunker (im Gegensatz zu vielen chinesischen Städten) nur noch in geringer Zahl das Stadtbild und der Blick vom Victoria’s Peak auf die imposante Skyline Hongkongs entschädigt für alles: Wie ein funkelnder Juwelenhaufen, eingekesselt von den steilen, dicht bewaldeten Hängen strahlt Central in seinem stillen Glanz; nur von fern wird das beständige Rauschen des Verkehrs an den Betrachter herangetragen. Ein irres Leuchten geht von den Schluchten zwischen den Bankgebäuden aus, ein Hinweis auf das pulsierende Leben dort unten, wo Neonreklame und ein babylonisches Geschnatter die Nacht zum Tag werden lassen. Vergleichbar mit dem Turmbau zu Babel ist auch die Hybris der Architekten und Stadtplaner, die aus dieser Perspektive offensichtlich ist: Der geografisch bedingte Platzmangel forciert schritt- und schichtweise den Ausbau in die Vertikale, sodass Metro-Schächte unter der Stadt und den Gewässern verlaufen; darüber ersticken die Straßen am Verkehrsaufkommen und für Fußgänger wurde schon längst eine weitere Ebene von Hochwegen eingezogen. In Hongkong, dem Moloch der Zukunft, erwartet man beinahe Ströme von futuristischen Vehikeln auch in der Luft, so sehr erinnert die hektische Betriebsamkeit an die Metropolen aus Star Wars. Obwohl der Autoverkehr nicht (wie in China) Jagd auf den arglosen Passanten macht und – oh Wunder! – auf permanentes Hupen verzichtet, haben es Fußgänger schwer in Hongkong. Die gesamte Uferpromenade ist eine riesige Baustelle und eine schlechte Beschilderung erschwert den Weg über mehrere Ebenen, durch Malls, über Rolltreppen und Tunnel. Auch das hochgelobte Metrosystem kann unseren Erwartungen nicht gerecht werden, da wir zugegebenermaßen an das hervorragend einfache Pendant aus Shanghai gewöhnt sind, das mit kürzeren Wegen und einer unmissverständlichen Farbkodierung punkten kann.
Beiden Systemen gemein ist die unkomplizierte Bezahlung per Prepaid-Karte mit eingebautem RFID-Chip, die ohne Bargeld und Berührung auskommt. Die Hongkonger Octopus-Karte lässt sich jedoch nicht nur in der Metro, der Tram oder den Doppeldecker-Bussen, sondern auch in zahlreichen Geschäften einsetzen – kein Wunder angesichts der klobigen Münzen von beträchtlichem Gewicht. Nicht ganz so modern ist eine Fahrt mit der Fähre von einer Insel zur anderen, die für 20 Eurocent als eine ausgesprochen günstige Hafenrundfahrt gelten darf. Dieses Fortbewegungsmittel ergänzt das heutige Hongkong, das stets in Eile zu sein scheint, um eine entschleunigende Komponente. Ganz ohne zischende Türen und dichtes Gedränge erlebt man hier das maritime Flair der Stadt (abermals im Gegensatz zu Shanghai, dieser anderen „Hafen“-Stadt); das Wasser ist türkis und die leichte Brise trägt den salzigen Meeresgeruch heran.
Während das Hongkong des ersten Tages mit seinem lauten Durcheinander auf den Straßen, mittelmäßigem Wetter und einigen ärgerlichen bürokratischen Hürden bei der Visumsvergabe einen insgesamt negativen Eindruck auf mich gemacht hat, so verkehrt sich meine Einstellung am nächsten Tag ins Gegenteil. Wir entfliehen mit einem Bus der dichten Bebauung und winden uns in Serpentinen über den bergigen Mittelteil der Insel, vorbei an luxuriösen Tennisplätzen und Villen mitten im Urwald bis hin zum Repulse Bay. Unterhalb der kleinen Baywatch-Häuschen können wir uns tatsächlich auf den langen Sandstrand legen und selbst das Wasser ist zum Schwimmen im Schutz der Hai-Netze nicht zu kalt.
Erst diese Facetten ergeben das vielseitige Gesamtbild von Hongkong: die zahlreichen Parks in ansonsten dicht bebauten Gebieten, wo sich die jungen philippinischen Haushälterinnen am Morgen treffen, die tropische Flora und Fauna und nicht zuletzt die zahllosen umliegenden Inseln. Auf Lantau Island, zur Hälfte ein Naturschutzgebiet, wacht die weltweit größte Statue eines Buddhas von seiner hohen Warte aus über den dazugehörigen Tempel und das Touristendorf; eine Seilbahn erleichtert den Abstieg bis zum vorgelagerten Flughafen. Die autofreie Insel Lamma Island bietet die Möglichkeit, in ungeahnter Abgeschiedenheit auf Wanderwegen zu flanieren, bis man die schläfrigen Fischersiedlungen bei der Fähre erreicht.
Weniger romantisch, dafür überaus schnell ist die Fähre nach Macao, deren hochtourige Gasturbinen schon von weitem hörbar sind. Circa eine Fahrtstunde auf Tragflügeln trennt Hongkong von Chinas anderer Sonderverwaltungszone, deren portugiesische Wurzeln wir in der Altstadt besichtigen. Rings um den zentralen Platz stehen eine Kirche und Verwaltungsgebäude aus der Kolonialzeit, in denen heute allerdings chinesisches und westliches Fastfood sowie Kleidung angeboten wird. Die Ruinen von St. Paul, Macaos Wahrzeichen, müssen gar mit einer überdimensionierten Panda-Figur um die Rolle als beliebtestes Fotomotiv ringen. In der höher gelegenen Festung befindet sich das Museum, das die ungewöhnliche Entwicklung der Insel recht anschaulich dokumentiert und im Eingangsbereich die zivilisatorischen Errungenschaften der europäischen bzw. chinesischen Völker gegenüberstellt und somit einen Bezug herstellt, der nicht nur auf Macao beschränkt ist. Nicht abgedeckt ist hingegen der jüngste und
prominenteste Wandel: der Boom der Glücksspielindustrie. Findige Geschäftsleute, zumeist aus Las Vegas, erkannten im Jahre 2002 das Potenzial der wachsenden chinesischen Mittel- und Oberschicht, ihren neu erworbenen Wohlstand beim Glückspiel zu riskieren, woraufhin Ableger des Venetians und anderer bekannter Kasinos in Macao eröffnet wurden – mit berauschendem Erfolg. Kasino-eigene Shuttle-Busse transportieren nicht enden wollende Ströme von Glücksrittern kostenlos von jedem Punkt der Insel in das drittgrößte Gebäude der Welt, in dem sich Hotelzimmer, Spielautomaten, Malls und natürlich – als Gipfel der Oberflächlichkeit – der überaus beliebte Nachbau der venezianischen Kanäle mitsamt singender Gondoliere befinden. In Anbetracht einer solch protzigen Gigantomanie verwundert es weiter nicht, dass Macao sein Vorbild Las Vegas umsatzmäßig schon längst um ein Vielfaches übertroffen hat und einer rosigen Zukunft entgegenblickt.
Zurück in Hongkong verfolgen wir ein letztes Mal die (unzensierten!) BBC-Nachrichten zum Atomunfall in Japan und bereiten alles für die Abreise vor. Noch bevor das Flugzeug am nächsten Morgen die Landebahn verlässt, überkommt uns ein schwer greifbares Gefühl von Fernweh. Sind wir nach einem halben Jahr kultureller Offenheit plötzlich rückfällig geworden? Vermissen wir schon jetzt das englische Frühstück im Café du Coral, die Bevölkerung, die nicht spuckt, oder sonstige Auswirkungen des britischen Kulturexports? Ganz im Gegenteil: Es ist eher diese Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Landschaften, von Nationalitäten und Biografien, die Hongkong um ein Vielfaches aufregender machen als das mittlerweile vertraute Shanghai. Auf kleinsten Raum komprimiert findet man hier den wahren Schmelztiegel Asiens.
- Aussicht vom Hostel
- Glasfassaden
- Touristen-Dschunke
- Uhrenturm in East Tsim Sha Tsui
- Museum of Teaware
- Jan Luis am Strand
- Peak Tram
- Skyline
- Skyline
- Skyline
- Touristendorf
- Seilbahn Richtung Flughafen
- Fast-Food-Dim-Sum
- Lamma Island
- Seafood auf Lamma Island
- Seafood auf Lamma Island
- „Please mind the gap“ auf Kantonesisch
- TurboJet-Ferry
- IPhone-Fotografin
- Panda vor St. Paul
- Venezianische Kanäle
- Nathan Road bei Nacht
- Buddhistischer Tempel
- Wanderweg auf Lamma Island
- The Venetian
Veröffentlicht unter Allgemein Kommentare deaktiviert für Hongkong – Liebe auf den zweiten Blick
Oben ist der Himmel, unten sind Suzhou und Hangzhou
Diesem chinesischen Sprichwort zufolge kommt Hangzhou dieselbe paradieshafte Bedeutung zu wie unserer letzten Reise-Destination, Suzhou. Tatsächlich ist der örtliche Westsee von unzähligen Poeten romantisiert worden und findet sich nicht zuletzt auf der 1-Yuan-Note.
Mit 4,3 Mio. Einwohnern ist Hangzhou zwar nach hiesigen Maßstäben eine Kleinstadt, doch ihre dokumentierte Geschichte von über 4700 Jahren lässt sie aus der Masse herausstechen, ebenso wie die überaus pittoreske Touristenmeile in der Innenstadt. Während sich hier ausgewiesene Luxusmarken wie Aston Martin, Gucci oder Prada tummeln, ist die sonstige Architektur eher gesichtslos, wie in so vielen chinesischen Wachstumszentren.
Recht zentral befindet sich auch eine Kirche, von außen gut durch ein kreuzförmiges Fenster kenntlich gemacht. Die letzten Klänge des gerade beendeten Gottesdienstes lagen noch in der Luft, als wir eintraten, sodass sich eine eigenartige Ambivalenz aus Vertrautem und Ungewohntem ergab. Das Gedeck für das Abendmahl erschien konventionell zu sein, eine Orgel hingegen fehlte. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter kam die Frage auf, ob es sich um ein katholisches oder evangelisches Gotteshaus handele. „We don’t really care – it’s basically Jesus“, lautete sinngemäß die Antwort.
Der Westsee war selbst für unsere deutschen, d.h. natur-verwöhnten Augen eine angenehme Überraschung und das nahezu mediterrane Flair (Sonnenschein inklusive) erlaubte es uns, den dritten Advent im T-Shirt zu verbringen. Dementsprechend begrenzt war denn auch unsere weihnachtliche Stimmung zu diesem Zeitpunkt…
Wie paradiesisch die Umgebung Hangzhous für Großstadt-Chinesen erscheinen muss, wurde durch ein oft wiederkehrendes Phänomen eindrucksvoll aufgezeigt: Foto-Tourismus für die eigene Hochzeit. Man stelle sich folgende Szene vor: Am sonnenbeschienen Ufer des Sees hält ein schwarzer Van. Drei Paare in Hochzeitskleidern springen überfallartig heraus, getrieben vom Fotografen und seinen Assistenten. Letztere modellieren noch, nicht eben zimperlich, den Bauch des Bräutigams, um die Sicht auf die dahinter liegende Pagode freizugeben und das Ensemble möglichst heroisch aussehen zu lassen. Und während sich die Augen der Fotografierten noch nicht an das grelle Licht gewöhnt haben, wird schon das nächste Paar herbeigezerrt. Angeblich machen solche Fotos einen Großteil der Ausgaben zur Trauung aus und werden bei betuchten Eheleuten vorzugsweise in Paris oder Venedig aufgenommen.
Besagte Pagode, eben noch verdeckt durch die männliche Leibesfülle, war das erste Ziel unserer Tour. Nachdem die Eintrittskarten gekauft waren und wir das Edelstahl-Drehkreuz passiert hatten, eröffnete sich uns ein imposanter Anblick: Gesäumt von wenig frequentierten Treppenstufen führte eine in den sozialistischen Trendfarben gelb, violett und grün schimmernde Rolltreppe hinauf zu der Pagode. Nur wenige Schritte weiter befördern zwei hochmoderne Fahrstühle die Besucherströme in luftige Höhen, wo man unwillkürlich von der Besucherplattform eine vollautomatische 360°-Drehung erwartet.
Ebenso obligatorisch wie der Besuch der Pagode war für uns eine Bootstour auf dem See. Zwar ließ sich unser Gondoliere partout nicht zum Singen überreden, die leichte Briese gab uns aber endlich das maritime Gefühl, das in der Hafenstadt Shanghai nie aufkommt. Pünktlich zum Sonnenuntergang erreichten wir das Ufer, von dem aus wir die Wasser-Show zu Chopins neuesten treibenden Beats genießen konnten.
Als eigentlicher Höhepunkt unseres Kurzurlaubes stellte sich der letzte Tag heraus, an dem wir uns Klappräder mieteten, die vermutlich an einer deutschen Fahrrad-Prüfung grandios gescheitert wären. Ohne Gangschaltung (dafür aber mit vielen Stopps, um die herausgesprungenen Ketten wieder einzulegen) machten wir uns an die schweißtreibende Fahrt in die südlich gelegenen hügeligen Tee-Anbaugebiete. Das nichtssagende Museum zu diesem Sujet ward schnell vergessen, als wir, beschienen von der abendlichen Sonne, auf einer abgelegenen Terrasse den berühmten grünen Tee und geröstete Wassermelonenkerne serviert bekamen. Gestört wurde diese Idylle lediglich von drei dröhnenden Ferraris, die mit unverminderter Geschwindigkeit durch die Dorfstraßen schossen. Um jedoch im Bilderbuch zu bleiben: Jan-Luis und ich folgten einer alten Dame, vorbei an freilaufendem Federvieh, hinauf in die Tee-Plantagen, wo wir einige Blätter zu kaufen gedachten. Obwohl der Preis anscheinend mit den zurückgelegten Höhenmetern zunahm, gaben wir uns der Vorstellung hin, einmal kein industrielles Massenprodukt zu erwerben und griffen nach einer ausgiebigen Kostprobe zu.
- Innenstadt
- Seifenblasen-MP
- Patrick, Julia, Freddi
- Pagode zwischen Zweigen
- Bequemer Tourismus
- Glocken in der Pagode
- Westsee
- Flüchtige Kalligraphie
- Ufer-Promenade
- Fashion Shoot
- Moi-même
- Friederike, Julia
- Philipp und Patrick während der Gondeltour
- Julia, Annika
- Jan-Luis, Ich
- Boot im Sonnenuntergang
- Stop Motion?
- It’s basically Jesus
- Free Rider
- Hochzeits-Foto-Shoot
- Tee-Plantage
- Kostprobe mit versammelter Runde
Veröffentlicht unter Allgemein Kommentare deaktiviert für Oben ist der Himmel, unten sind Suzhou und Hangzhou
Suzhou – Venedig des Ostens
Eine Seltenheit in China: Statt aufstrebender Hochhäuser bestimmen in Suzhou, einer kleineren vorgelagerten Stadt, nahezu unveränderte Tempelanlagen, Gärten und Kanäle den Stadtkern, denn im Gegensatz zu Shanghai kann Suzhou auf eine rund 2500-jährige Geschichte zurückblicken.
Den Ruf als „Paradies auf Erden“ erwarb die Stadt durch ihre wohlhabende Bevölkerung: Nicht wenige Mandarine und Kaufleute beschäftigten Künstler, um sich einen angemessenen Ruhesitz zu schaffen. So bringt es beispielsweise der „Garten der Politik des einfachen Mannes“ auf über 50.000m² und gehört damit zu den vier berühmtesten Gärten Chinas. Nach dem klassischen Ideal ist er eine Miniaturlandschaft, frei von jeder Beliebigkeit. Früheren Gelehrten soll die Konzeption des Zusammenspiels von Pflanzen, Teichen, Felsen, Brücken und Bauwerken eine herausfordernde Aufgabe gewesen sein – uns Großstadtbewohner erfreut vor allem die Stille und die Natur. Selbst die leiernde Lautsprecher-Musik scheint an diesem Ort zur Entspannung beizutragen.
Sieht man von den penetranten Anbietern von Stadt-Touren ab, so kann man tatsächlich etwas wie Ursprünglichkeit verspüren. Besonders im Vergleich zu Shanghai, Schließlich bestechen die dortigen vergleichbaren Gärten zumeist mit Beton-Elementen, einem unübersehbaren Ölfilm auf den Gewässern und dem ewigen Lärm von diversem Baugerät.
Doch auch Suzhou kann mit modernster Architektur aufwarten: Der Architekt der Louvre-Pyramide schuf die Räumlichkeiten für das hiesige Museum. Handwerkskunst aus Bronze, Jade, Porzellan und Textilien zeugen von einer früheren Hochkultur und kosten noch nicht einmal Eintrittsgeld. Anstellen und ein Ticket erhalten muss man allerdings trotzdem – in dieser Hinsicht sind die Chinesen noch pingeliger als selbst die Deutschen.
Eine überaus denkwürdige Rikscha-Fahrt brachte uns später zum „Tempel des Geheimnisses“, einer daoistischen Anlage. In Ermangelung eines Taxis wendeten wir uns einem eifrigen Rikscha-Fahrer zu, der schnell einwilligte, uns an unser Ziel zu bringen. Dass das wackelige Gefährt mit vier Personen hoffnungslos überladen war und dem Fahrer wohl einen Herz-Kollaps bescheren würde, begriffen wir spätestens, als wir (ohne Bremse) im Gegenverkehr eine Hauptstraße entlangfuhren. Eine ähnliche Erkenntnis schien auch den Fahrer ereilt zu haben, jedenfalls verkündete dieser nach einem Bruchteil der Strecke, wir hätten das Ziel erreicht.
Immerhin: Der Ausblick von der 76m hohen achteckigen Nordtempel-Pagode reicht bis zu den umgebenden Hochhäusern und die weitläufige Anlage bietet Einblicke in das Zeremoniell der Mönche und der Betenden.
- Gedenken an die Ahnen
- Nordtempel-Pagode
- Jan-Luis
- Hochhäuser fern vom Stadtkern
- Mondtor
- „Ich war hier“
- Elfenbein-Schnitzerei im Suzhou-Museum
- Suzhou-Museum
- Suzhou-Museum
- Müll-Fischer
- Venedig des Ostens
- Garten der Politik des einfachen Mannes
- Philipp
- Pagode
Veröffentlicht unter Allgemein Ein Kommentar
Wer war der größte Erfinder aller Zeiten?
Die (ohnehin unwichtige) Antwort des Gegenübers abwarten, ein altkluges Gesicht aufsetzen und mit gebührendem Nachdruck antworten: „Nein, es war die Natur!“
Wo man solche Bonmots von Zehnjährigen zu hören bekommt? Natürlich auf der DAAD Kinderuni Shanghai.
In der nunmehr sechsten Auflage bekommen Schüler Einblicke in die universitäre Forschung, um bereits frühzeitig ein akademisches Interesse zu entwickeln – ein Ansatz, der mittlerweile Leuchtturmcharakter hat und politisch gefördert wird. Insofern erklärt sich auch die Anwesenheit von professionellen Kameramännern und Fotografen für die abschließende Hochglanzbroschüre; schließlich funktionieren solche Projekte nach dem Prinzip „Gutes tun und darüber reden“.
Nach intensiver Vorbereitung, in deren Verlauf Banner, Urkunden und T-Shirts in den Werder-Farben entstanden und „Spontaneität“ zum Reizwort des gesamten Büros wurde, trafen also 46 Schüler im Bremen-Pavillon auf dem Expo-Gelände ein – fast ein Heimspiel also. Paritätisch aus Schülern der Deutschen Schule Shanghai und einer chinesischen Schule in Wuxi zusammengesetzt, um den Charakter der deutsch-chinesischen Partnerschaft zu betonen, gab es zunächst Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen. Wie es der Zufall wollte, war Nico, ein weiterer kulturweit-Freiwilliger, als Betreuer aus Wuxi angereist und konnte den Verständigungsschwierigkeiten entgegenwirken.
Die bilingualen Vorträge des Oldenburger Oberbürgermeisters und der Uni Bremen zum Thema Wissensmanagement bildeten den Rahmen für den anschließenden interaktiven Rundgang zu den Exponaten. Allgegenwärtig auch hierbei: Das Mantra von Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit; allerdings nicht ohne die an der Innovation (und am Sponsoring!) beteiligten Unternehmen explizit zu erwähnen. Das eifrige Niederschreiben der Informationen wurde alle sieben Minuten vom durchdringenden Pfiff meiner Trillerpfeife unterbrochen, um dann beim darauf folgenden Quiz von Nutzen zu sein: Abgesehen von der originellen Idee, die fernab der Küste gewonnene Windenergie per Schallwellen zu übertragen, konnten die Kinder etwa die Vorteile des Car-Sharings präzise auflisten.
Doch was wäre eine solche Verantaltung ohne Berücksichtigung des leiblichen Wohls? Geradezu klischeehaft deutsch wurden also im Hamburg-Haus Würstchen mit Kartoffelbrei und Sauerkraut serviert. Während Messer und Gabel mit einigen skeptischen Blicken seitens der chinesischen Schüler quittiert wurden, hatten wir Deutsche mit der plötzlichen Sehnsucht nach heimischer Kost zu kämpfen.
Derartig gestärkt, ertrugen wir auch die disneyfizierte Slapstick-Variante der Bremer Stadtmusikanten, in der nicht nur das Expo-Maskottchen (man munkelt, es sei einer Zahnpasta-Werbung entlaufen), sondern auch der Transrapid ihre Auftritte hatten. Erwartungsgemäß rundum verstörend; außerdem war der Hund krank. Nach ihrer Erlösung durften die Kinder auf der anderen Seite des Huangpu im Atelier Sebastian Heiners an der „Energie-Malperformance Drachenflug“ teilnehmen. Zunächst zögerlich, dann jedoch mit zunehmendem Elan wurden die Bildnisse vierer Drachen gepinselt, gekleckert und gespritzt – je unkonventioneller die Methode, desto besser.
Den Schlusspunkt für uns Mitarbeiter bildete die grandiose Aussicht vom Dach des Ateliers, vor den Umrissen der Stadt, denn nur silhouettenhaft zeichneten sich der Oriental Pearl Tower und das World Financial Center im Dunst Shanghais ab. Befreit von jeglicher Anspannung verlebten wir in gelöster Stimmung die (be-)rauschenden Feierlichkeiten des Generalkonsulates zum Tag der Deutschen Einheit.
- Nico, kulturweit-Freiwilliger
- Vorfreude bei der Deutschen Schule Shanghai
- Konzentration für das Quiz
- Forscher-Outfit für die Antarktis
- Über die Schulter geschaut…
- Stadtmusikanten mit den Unterschriften von Horst Köhler und Diego
- Tauchroboter
- Zwischen den Fakten des Car-Sharings
- Das ist mündliche Mitarbeit!
- Abschlussdiplom
- Bremer Stadtmusikanten feat. Expo-Männchen
- Vorher-Foto
- In Reih und Glied
- „Energie-Malperformance Drachenflug“
- Eimer mit Pinseln, Besen, Fliegenklatschen
- Konventionelles Gerät
- Die Hände eines Künstlers
- Das DAAD-Kollegium
- Wu Jing
Veröffentlicht unter Allgemein 3 Kommentare
Mondfest
Begibt man sich auf die Suche nach einem authentischen Ausdruck des Nationalcharakters in einem fremden Land, so vermutet man diesen zumeist in den landesweiten Feiertagen zu finden. Schließlich sind diese doch ein Spiegel des Stolzes, der Errungenschaften, Wünsche und Ängste eines Volkes in rituell konzentrierter Form.
Als eine solche Gelegenheit bot sich mir vor kurzem das chinesische Mondfest dar: Schon etliche Jahrhunderte vor Christi Geburt begann die herrschende Dynastie in China, dem zum Zeitpunkt der herbstlichen Tagundnachtgleiche außergewöhnlich hell scheinenden Mond Opfergaben zu erbringen. Im Laufe der Zeit rankten sich im Volksmund verschiedene Sagen um das Fest und man begann, einander Mondkuchen zum Geschenk zu machen. Traditionell gefüllt mit einem ganzen Eigelb (in Variationen heutzutage aber auch mit roten Bohnen oder Fleischfüllung) werden diese kulinarischen Besonderheiten zwar alljährlich massenweise verschenkt, jedoch hält sich der Genuss beim Verzehr – auch bei vielen Chinesen – in engen Grenzen.
Was ich allerdings erlebte, war wohl ebenso wenig authentisch, wie die vom Kommerz überformte Shanghaier Gesellschaft representativ für den Rest Chinas ist. Anstelle handgearbeiteter Mondkuchen mit dem symbolträchtigen Inhalt reichten wir unseren rund 25 Gästen (hauptsächlich Franzosen, einige Chinesen) mehrfach eingeschweißte und abgepackte Küchlein; komplettiert wurde das Menü durch die Mitbringsel der Gäste. Neben zwei großen Eimern voller Chicken Wings von KFC, die es hier unter Einheimischen zu erschreckender Popularität gebracht haben, fanden sich darunter überraschenderweise auch einige der in Deutschland längst totgesagten Alcopops. Internationale Blase?
Eine Anmerkung übrigens zu vielen chinesischen Feiertagen: Wirklich frei sind diese nicht, denn anders als in Deutschland muss die entgangene Arbeitszeit hier an anderer Stelle nachgeholt werden. Beim kommenden Nationalfeiertag, der sich in diesem Jahr zu einer ganzen „Goldenen Woche“ erstreckt, ist dies jedoch aus Prestige-Gründen anders und die in allen großen Straßen aufgehängten Flaggen lassen Großes erahnen…
Veröffentlicht unter Allgemein Kommentare deaktiviert für Mondfest
Oh Brave New World!
Samstag, 18. September 2010, Shanghai Pudong International Airport, 10.35 Uhr: Ich verlasse das doppelstöckige Langstreckenflugzeug und werde verschlungen von der längsten Gangway. Würzige Luft dringt durch die Konstruktion und ich kann die 35°C heiße Außenluft erahnen.
Die Koffer habe ich schnell beisammen und ich durchschreite langsam die Menschenmenge, den Blick unablässig auf die vielen Schilder gerichtet, mit denen Hostessen und Reisegruppenleiter um Aufmerksamkeit buhlen. Eine halbe Stunde und viele chinesische und japanische Gesichter später stellt sich mir Julia Mink, die Sprachassistentin vom DAAD, vor und wir besteigen zusammen eines der zahlreichen Taxis. Ohne Gurte zum Anschnallen geht es in halsbrecherischer Fahrt zu der Adresse, die wir dem Fahrer bislang nur in schriftlicher Form mitteilen können. Die Fahrt auf der vierspurigen Haupteinfallstraße in die Innenstadt ist kompetitiv und führt am Expo-Gelände über den Huangpu.
Am Zielort, der ehemaligen WG meiner Vorgängerin, treffe ich auf eine mir bis dahin unbekannte Französin, die mich und mein Gepäck freundlich in Empfang nimmt. Erleichtert um 46kg besorge ich Bargeld und erstehe unter Einsatz zahlreicher Gesten eine Metro-Karte.
Tatsächlich ist die Metro, an deren Eingängen je zwei Polizisten stehen, moderner als alle anderen, die ich bisher gesehen habe: Die Karte besitzt einen RFID-Chip und so kommen wir schnell am People’s Square, einer der meistfrequentierten Stationen, an.
Schon hier wird das vorherrschende Charakteristikum dieser Stadt, ihre Widersprüchlichkeit, deutlich: In unmittelbarer Umgebung hoch aufragender Wolkenkratzer findet sich an diesem Platz ein idyllischer Park, bepflanzt mit allerlei südlichen Gewächsen. Konterkariert wird die erholsame Atmosphäre dieser Oase allerdings durch die unbeschreiblichen Menschenmassen, die hier flanieren. Viele der überwiegend älteren Besucher gehen übrigens einer anderen Beschäftigung nach, wie mir ein freundlicher Chinese zu berichten weiß. Es handelt sich um eine Kontaktbörse, bei der Eltern versuchen, einen geeigneten Partner für ihre Sprösslinge auf den ausgehängten Steckbriefen zu erhaschen. Prompt kommt denn auch die Frage nach meiner Haltung den chinesischen Frauen gegenüber; mein Alter von 20 Jahren disqualifiziert mich jedoch als ernsthaften Bewerber.
Nach dieser Begebenheit geht es entlang der touristischen Haupteinkaufsstraße Nanjing Lu in Richtung Bund.
Diese Stadt ist der blanke Wahnsinn.
Tausende von Menschen, ein Hupen, ein Schnattern, zahllose Fast-Food-Ketten und Armadas von Motorrädern – das alles vor der Kulisse der neoklassizistischen Gebäude und nahezu mediterranem Flair. Mit diesem imposanten Hintergrund öffnet sich irgendwann der Blick auf die Skyline von Pudong: Vergesst alle Panorama-Fotos im Internet! Unter blauem Himmel glitzern irrwitzig hohe Gebäude in allen Farben und spiegeln die untergehende Sonne, die wiederum im Huangpu reflektiert wird. Ein unbeschreiblicher Anblick! Höchste Euphorie!
Nach einem kurzen Aufenthalt in der chinesisch-beengten Wohnung meiner Kollegin lassen wir den Abend in einem kleinen Restaurant ausklingen. Trotz mangelnder Übung erreiche ich mit den metallenen Stäbchen einen befriedigenden Sättigungsgrad und auch den Rückweg quer durch die Stadt finde ich problemlos.
Nach diesem Tag ist selbst der gefürchtete Jetlag zu erschöpft, um meinen Schlaf zu stören.
- Metro
- People’s Square
- People’s Square
- People’s Square
- People’s Square
- Saxofon-Konzert auf der Nanjing Lu
- Bus auf Nanjing Lu
- Motorroller-Armada
- Taxi
- Audi auf der Nanjing Lu
- Pudong hinter Menschenmassen
- Ehrfurchtsvoller Blick auf Pudong
- Pudong-Skyline
- Pudong unter Vollmond
- Pudong: Beliebte Foto-Kulisse
- Bund
Veröffentlicht unter Allgemein 3 Kommentare
1000 schleichende Abschiede
 Dass die Tage in der Heimat gezählt sind, merkt man spätestens dann, wenn das Haltbarkeitsdatum der Milch im Kühlschrank das Ausreisedatum übersteigt.
Dass die Tage in der Heimat gezählt sind, merkt man spätestens dann, wenn das Haltbarkeitsdatum der Milch im Kühlschrank das Ausreisedatum übersteigt.
Graduell verschwinden Institutionen aus meinem Leben, die über Jahre hinweg den Rhythmus bestimmt haben: Ein letztes Mal Musikunterricht, ein letztes Mal im Sportverein. Freunde fallen einem mit den Worten „Falls wir uns nicht mehr sehen…“ beim Abschied in die Arme und verleihen ihrer Überzeugung, ich müsse angesichts der nahenden Abreise schier verzweifeln, mit mitleidigen Blicken Ausdruck.
Aber Abschiedspanik? Mitnichten!
Das Ausbleiben jeglicher sentimentaler Ergüsse ist wohl einer diffusen Mischung aus Optimismus, Neugier und einer gehörigen Portion Naivität geschuldet.
Ich habe Reiseführer, Romane und Zeitungsartikel über China gelesen und habe die Eindrücke meiner Vorgängerin, Lea Schneider, in ihrem Blog verfolgt.
Ich habe einen Sprachkurs belegt, Filme und Bilder über Shanghai gesehen und das Visum befindet sich bereits im Reisepass.
Ich ertappe mich dabei, wie ich insgeheim Partei für die chinesische Kultur ergreife und mich vehement Vorurteilen meiner Bekannten entgegenstelle (was nicht immer berechtigt sein mag – viel mehr gehört es wohl zu der eigennützigen Verklärtheit, die jeder entwickelt, der längere Zeit im Ausland verbringt und das Fremde zum Teil seiner Identität macht).
Dennoch: Shanghai ist zum jetzigen Zeitpunkt noch seltsam unwirklich, nicht greifbar. Es ist ein Postkarten-Panorama, ein Punkt auf der Landkarte und ein Name, der aufregend-verruchte Assoziationen wie Opium-Kriege, ausländische Konzessionen und gnadenlosen Frühkapitalismus hervorruft; zumindest wenn man von skeptischen Kommentaren à la „Shanghai?! Warum gehst du denn nicht nach Neuseeland oder so?“ absieht.
Vermutlich läuft es auf Louisas Erkenntnis zu ihrem Schüleraustausch in den USA hinaus: „Man realisiert es weder kurz vor der Ausreise, noch während des folgenden Jahres. Erst zurück in Deutschland wird man gewahr, dass man gerade ganze zwölf Monate fernab der Heimat verbracht hat.“
Veröffentlicht unter Allgemein Kommentare deaktiviert für 1000 schleichende Abschiede