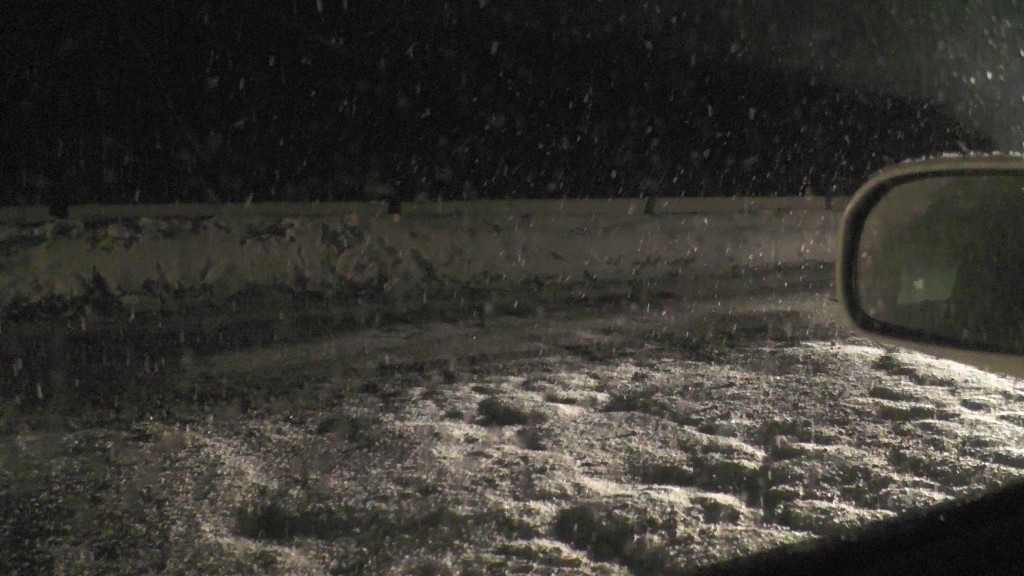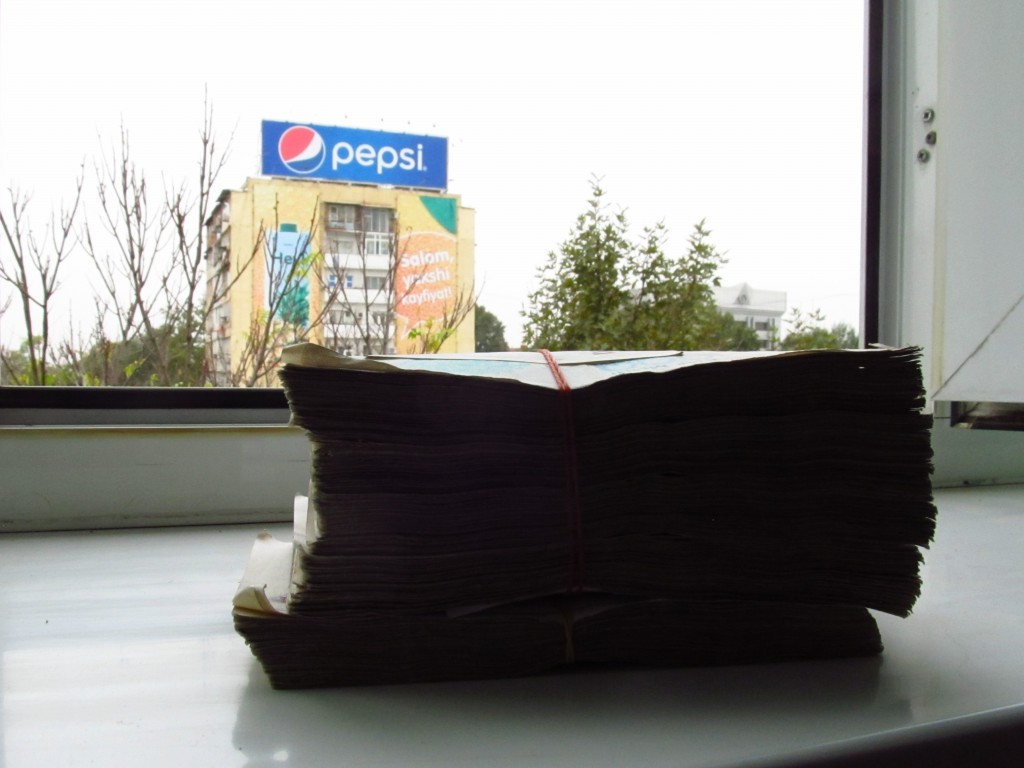Die zweite Woche – vielleicht der Punkt, an dem sich mein Da-Sein zu unterscheiden beginnt von jenem des Touristen – an dem die erste Dinge Alltag werden. So etwas zu beobachten ist beruhigend; es sagt: Man kommt an. Man IST da, und wird bleiben. Ich hatte überlegt, einfach meine Woche zu beschreiben, Einblick zu geben in Alltag und Struktur meiner Arbeit, aber… es ist mir doch zu langweilig und irgendwie anspruchslos. Ich möchte literarisch werden, ausholen und weit schweifend über meine Seelenlandschaft fahren, jene Eindrücke des Auges wiederholend, verwandelnd, komprimierend auf abstrakter Ebene nacherzählen, dabei gleichsam einem Märchen in unmissverständlich belletristischer (pathetischer) Sprache die Distanz erhalten zu mir, zum Leben, denn – ich kann nicht die ganze Zeit herumlaufen und reflektieren, in welcher Bedeutung ich dieses soeben, vorhin, letzte Woche Erlebte zu sehen habe, Teil welches lebensverändernden, einschneidenden Prozesses es ist und welchen Beitrag es leistet zu einem anderen Ich – oder eine höhere, andere Realität erfahrbar macht. Das immerhin kostet Anstrengung, Überlegung, Kraft – die habe ich noch nicht. Denn Müdigkeit begleitet mich, die des Neubeginns, Anfangens, es schleppt sich hin, über die Tage, und ich verstehe meinen Körper, dass seine Antwort auf mein Fordern am frühen Abend bereits Ablehnung signalisiert – und Erschöpfung, ja, aber nicht jene, von der ich im zweiten Eintrag schrieb. Nicht die „Erschöpfung des Europäers“, der so durch die Fremde wandert und zähneknirschend seine Identität zerpflückt, der erledigt von seinen körperlichen Beschwerden den geistigen Rückzug antritt und bei sich ist aus zitternder Selbsterhaltung, aus dem Klammern an das eigene Ich oder das, was davon noch bleibt, wenn der Rest versagt, der Körper – die Erschöpfung der zweiten Woche ist anders; sie ist Sanftmut, ein Streicheln des Kopfes, Komm, leg dich hin, sie ist weich und lächelt, wenn sie winkt. Ihr Kommen ähnelt einem Abgleiten nicht in die Höhlen von Schmerz und Notwendigkeit, sondern Vertrauen und Aufbau. Wenn die ersten – die ersten sind die schwersten – Schranken abgebaut sind, kann sich der Kopf, das Ich im Denken, akklimatisieren. Aber sie ist auch eine Erschöpfung des geistig Rastlosen, der so viel in seinem Kopf bewegt, den es nach Ruhe dürstet und nach Beisein des Denkenden, Schöpfenden, jenes Teils meines Ichs, das mir der Anker während zwei letzter Jahre Schule war. Es war diese Woche wieder, dass ich Lust bekam, dass mich das altbekannte Verlangen packte, nach Lesen, Schauen, Kunstrezeption und –produktion – nein, eher ersteres, denn Produktion, dafür ist alles noch zu viel, und der Blog genügt mir als Abfluss meiner Wallungen, meines geistigen Treibens – das und der Schlaf, die Träume, die mich süß empfangen – genug der ersten Worte, ich habe noch viele weitere zu verlieren und schenke sie gerne aus.
Indem ich mit einem Abriss dessen beginne, was meine Woche war: Montag ein ruhiger Beginn, aller Anfang ist träge. Eine kurze Einführung ins CMS (Content Management System), das ich lieber anderen überlassen würde, und Arbeit an einigen Kleinigkeiten – Papieren, die noch waren, Beginn der kurzen Schrift an die Institutsleiterin wegen einem überregionalen Projekt, zu dem zur Rückmeldung aufgerufen wurde. Essen: Kantinen-Borschtsch auf dem Basar. Dienstag ein schöner Arbeitstag, den ich tatsächlich frisch rekapituliert und protokolliert habe – die ausführliche Beschreibung also unten. Wichtig: ein neues, großes Projekt, das ganz schnell über die Runden muss. Sehr abwechslungsreich und deshalb Grund für mehr Worte der Mittwoch: aus irgendeinem Grund, der vielleicht mit Ausstellungen, Politik oder Wochenende zu tun haben mag, feierte die Weltsprachenuniversität in Taschkent den Europäischen Tag der Sprachen (26.09.) am 23.09. Die Uni selbst ist wahrlich kein sehenswerter Bau, aber traditionell war das Goethe-Institut (wie das British Council und eine französische Vertreterorganisation) vor Ort. Stände verschiedener europäischer Länder (u.a. Deutschland, Frankreich, Georgien, Lettland, Rumänien, Spanien, Slowakei, England, Ukraine) waren zentral irgendwo aufgebaut und als Goethe-Institut stellten wir uns einfach an den deutschen Tisch, unser Banner daneben. Ich hielt mich von dem Gedränge eher fern, man will ja nicht ständig fotografiert werden. Obwohl es sehr nett ist, den strahlenden, hoch motivierten, usbekischen, deutschsprechenden Mädchen zu erzählen, woher man kommt – als würde sie nichts glücklicher machen, als mit Originaldeutschen, deren Sprache sie studieren, Small Talk zu betreiben und Fotos zu knipsen. Ich merke immer wieder, dass man als Ausländer (insb. Europäer, insb. Deutscher) hier eine Art „besonderen Stand“ hat – einige Tage später sprach mich einer auf Russisch an, ich sagte, ich spräche nicht besonders gut und habe seine Frage nicht verstanden, er fragte mich, woher ich käme: Deutschland. Was ich hier mache, „You know, it is very interesting for me.“ – mit einem Deutschen zu reden…
Ich musste natürlich unbedingt zum lettischen Tisch, voller Hefte über Riga, verschiedene Unis; alles auf Russisch. Nur das Banner, dessen Logo ich kannte: Latvia. Best enjoyed slowly. Als ich ein Gespräch zu beginnen versuchte (in dieser wunderschönen Sprache, deren Wörter in meinem Mund so schnell Russisch werden), meinte die Hüterin des ganzen Papiers, hinter dem Tisch im Schatten sitzend, sie verstehe, aber spreche leider kein Lettisch. Trotzdem haben wir uns – Englisch – unterhalten und sie meinte, ich könne doch mal bei einer der Botschaftsveranstaltungen kommen. Gerne. Wenigstens die Rede des lettischen Botschafters, ein Hüne mit Sonnenbrille im mafiagrauen Anzug, habe ich mitbekommen – die kürzeste von allen. Was nicht unklug war, denn das Rednerpult (nachdem man die Technik aus dem Saal, in dem vormittags die unwichtigeren Reden über Spracherwerb und Mehrsprachigkeit gehalten wurden, hinaus transportierte) stand, schattenlos, der prallen Sonne (prall ist das falsche Wort, scharf trifft es eher) preis gegeben (durch die blöde Klammer hat nicht einmal das Wortspiel – „der prallen Sonne preis“ funktioniert) – wo war ich? Die Sonne. War wirklich knallig an dem Tag. Was noch zu erwähnen wäre, ist die deutsche/deutschsprachige community in Taschkent, die man manchmal sieht, und meist wohl bei Veranstaltungen wie diesen. Nur, dass ihr wisst: es gibt eine. Donnerstag Feiertag – islamisches Opferfest, oder Beginn desselben; ich kenne niemanden, der es zeremoniell begangen hat. Dennoch bedeutete es einen freien Tag für mich – der einzige dieser Woche, weil ich am Samstag und Sonntag (s.u.) arbeiten musste – wie ich ihn genutzt habe, liest man in dem anderen neuen Eintrag (mit Bildern!) über den Chorsu-Basar. Mehr habe ich an dem Tag nicht gemacht. Dafür war der Freitag wieder einer der Büroarbeit – Lesen, Begreifen, Zusammenfassen, alles auf Englisch. Es ging um das große Projekt; ich musste aus internen (geheimen!) Protokollen und finanziellen Bilanzen bestimmter „Maßnahmen“ die Zusammenfassung eines zurückliegenden Mega-Projektes schreiben, welche eben nun nötig war. Ich weiß nicht, wie viel zu viel wäre – wir als Goethe-Institut bewerben uns bei einer offenen EU-Ausschreibung in Usbekistan um ziemlich viel Geld und der englische Antrag ist eine Heidenarbeit, die wir praktisch spontan zu übernehmen beschlossen haben. So läuft das.
Wie bereits gesagt, bestand mein Wochenende aus Arbeit, aber angenehmer: über die beiden Tage fand im Institut der zweite Teil eines Fotografieworkshops statt, den der aus dem zweiten Beitrag bekannte Fotograf begleitete – es ging um die Präsentation einer Aufgabe, welche die Teilnehmer während der vorangegangenen Woche zu erarbeiten hatten: eine Fotoserie zum Thema „Der Basar“. Am Samstag schaute ich ihnen noch viel zu, Sonntag lieber zwei Filme an, oben, in „meinem Büro“ – Sichtungen für eine ab Februar 2016 stattfindende Filmreihe. Die „Arbeit“ hielt sich also an den beiden Tagen in Grenzen, als Vertretung des Goethe-Instituts und theoretisch Ansprechperson der Programmabteilung musste ich vor Ort sein.
Ich komme wirklich viel mit einer Internationalität in Kontakt, die ich aus Deutschland nicht kenne, die sich selbst in Lettland meist zwischen deutsch-russischen Grenzen bewegte. Es ist allerdings auffällig, wie oft ich den Vergleich zu Lettland ziehe – ein Jahr in der Fremde ist einzigartig, und ein weiteres fühlt sich wie Widerholung an. Ich denke oft, wie ähnlich Elmira meiner lettischen Gastmutter scheint; die Jugendlichen hier und da sehe ich im Kopf oft zusammen, mein Zimmer fühlt sich plötzlich wie jenes an, in dem ich in Inčukalns schlief, schrieb, arbeitete – nur der Wald fehlt, das liebe Schweigen der Bäume, die Ruhe dieses kleinen Ortes, das Lauschen auf etwas da draußen – hier ist alles viel härter, stumpfer – Großstadt – weniger rosagold, wie ich mein Lettland zu verklären tendiere… Außerdem scheinen die Momente des Wiedererkennens kurz, dann ist Elmira wieder Usbekin und ganz und gar nicht jene lettische Mutter mehr. Dann höre ich wieder in ihrem usbekischen Gespräch ein lettisches Wort und ich lächle, weil mein Verstand mich austrickst – es ist ja gut, die Erinnerung an Lettland – ein Zauberjahr, rosagold verklärt…
Das Protokoll wird fortgeführt: Mir schien, ich erwähnte es, der Dienstag, 22.09., ein für die Arbeit, den „Alltag“ hier, sehr charakteristischer Tag, deshalb werde ich nun verarbeiten, was ich mir notiert habe. Der Wecker klingelt um halb Acht, derselbe Klingelton seit Jahren: „Sunday Morning“ von The Velvet Underground. Mein altes Handy, auf dessen letzten Seufzer ich langsam warte. Ich stehe auf, mein Rücken schmerzt etwas, ich muss auf die Toilette – nichts Besonderes bei neun bis zehn Stunden Schlaf pro Tag. Ich bin bestimmt trotzdem müde. Gehe ins Bad, auf Toilette, in die Dusche – das Wasser braucht lange, um warm zu werden, und ist es einmal warm, dann ist es heiß – Frühstück. Ich setze Wasser auf – Gasherd, Teekanne – und fange schon an zu essen: Kefir, Balsam für den Magen (fast so gut wie Wodka), und das berühmte, helle Rundbrot – Lepjoschka. Die Teekanne bläst Wasserdampf, der Deckel klappert, ich gieße den Teebeutel zum vierten Mal auf, lasse nur kurz ziehen und schmeiße ihn weg. Mein Tipp für Bauchschmerzen-Aufenthalte in Usbekistan: Kefir, Brot und dünner Schwarztee – es gibt nichts Besseres. Kurz nach halb Neun verlasse ich die Wohnung, sperre wieder ab, und gehe mit meinem (schnell gepackten) Rucksack die Treppe herunter – seltsam ungleichmäßige, häufig ganz niedrige Stufen. Immer dabei: Wasser (Hydrolife aus dem Tian-Shan statt Nestlé), Thermosbecher, Fotokamera, Block, Stifte und ein Tüte voll Geld. Ganz nebenbei: Geld zählen macht Spaß. Wenn man bei Achtzig angekommen ist und sich nicht sicher, ob man sich verzählt hat, dann wieder von vorne beginnt… 1000 Sum, der übliche Schein, das sind 20 Cent. Mehr als 5000 auf einem Stück Papier geht nicht. Man kauft ein, 11.000 Sum, und zählt elf Scheine ab – ohne Kleingeld und „Haben Sie vielleicht sieben Cent?“. Obwohl mich jemand fragte, ob ich (bei 6000 Sum, die ich ihr gab) nicht noch 200 hätte – also vier Cent, der kleinste Schein. Hatte ich nicht und sie musste mir 400 (zweimal 200) zurückgeben, ansonsten hätte sie mir 500 (ein weiterer Schein) geben können. Diesen kleinen Verlust muss man verkraften können, auch wenn ein Einkauf nicht 11.000, sondern tatsächlich 10.960 Sum kostet – und wieder: zu Zeiten des Lats war das in Lettland ähnlich, das Aufrunden der Summen wegen fehlender Kleinstwerte.
Der Bus, den ich jetzt gewohntermaßen nehme, Linie 38 oder 57, ist mit 1000 Sum neben der Metro das günstigste Transportmittel – ein Platz in der Marschrutka, die Elmira immer nimmt, kostet 1200. Mir gefallen diese grünen Mercedes-Busse, aus denen man den Weg entlang die Stadt sehen kann. Etwa 20 Minuten dauert die Fahrt bei dichtem Verkehr; ich steige am Oloy (Alaiskij) Basar aus. Zu diesem Zeitpunkt hat der Kontrolleur meist gegen jenes Entgelt Tickets von seiner Papierrolle verteilt; vorher steigt er an den Haltestellen aus, bekommt von den Entsteigenden das Geld in die Hand gedrückt und sprintet, im Anfahren des Fahrzeugs, nach vorne, um vor dem Schließen der Tür (der Fahrer reguliert das schon entsprechend) aufzuspringen.
An diesem Morgen muss ich zu UMS, der Telefongesellschaft, bei der ich eine Karte erworben habe. Irgendwie soll ich sie freischalten und weiß nicht, wie. Nach dem Besuch in dem auch an den Schalter fast leeren Gebäude bin ich auch nicht schlauer, denn der unmotivierte Mensch am Infodesk sagt mir etwas auf Russisch, das ich nicht verstehe. Heute spricht niemand Englisch. Also gehe ich wieder. Später kommt mir in den Sinn, in den hintergelagerten Raum zu gehen, wo zwei „Kassa“-Schalter die richtigen Assoziationen wecken, die richtige Anlaufstelle sind. Nun gut.
Viertel nach Neun bin ich auf Arbeit, d.h. an jenem Schreibtisch, von wo aus ich dies ins weite Netz stelle. Ich begrüße die, die da sind, andere kommen im Verlauf des Tages und grüßen mich – ein sehr nettes Klima; alle grüßen sich gegenseitig, ich fühle mich zugehörig. Das erste, das ich an meinem Arbeitsplatz mache: Facebook und Googlemail. Was man so macht, wenn man zu Hause (!) kein Internet hat. Ich sende eine Mail an meine Eltern, die ich am Laptop in der Wohnung vorgeschrieben und nun auf einem USB-Stick mitgebracht habe und kläre mit der Institutsleiterin meinen Urlaub zum Zwischenseminar – so halbwegs.
Um Viertel nach Zehn beginnt der wöchentlich dienstags auf Zehn angesetzte Jour Fixe der Programmabteilung, ein wichtiger Punkt, um Informationen zu den verschiedenen Projekten, teilweise laufend, teilweise in Vorbereitung, auszutauschen. Ich führe Protokoll. Heute sind außer der Institutsleitung und dem Leiter der Programmabteilung noch zwei Kulturmanager dabei: das große EU-Projekt wird diskutiert und beschlossen, die Arbeit verteilt; keine Zeit darf verloren werden. Als die beiden gehen, gönnen wir uns eine kleine Pause und ich darf mir (darf ich auch regulär) einen Kaffee in der Maschine der Institutsleiterin machen – so richtig, aus gemahlenen Bohnen… Ansonsten nur (im Supermarkt nicht nur) Nestlé Instant Kaffee. Die anderen Themen handeln wir so schnell es geht ab und sind um halb Eins fertig. Das Protokoll tippe ich sofort in eine standartisierte Tabelle ab und habe später einige Schwierigkeiten mit CMS-Inhalten – Ankündigung von Veranstaltungen. Wer also auf www.goethe.de/taschkent geht und auf „Veranstaltungen“ klickt, der wird u.a. meine Arbeit (hauptsächlich Copy-Paste) bewundern können. Großartig. Ich verlagere alle weiteren Aktivitäten in der Hinsicht auf die andere Praktikantin aus Leipzig (!), die schon länger als ich da ist und ein halbes Jahr bleibt.
Ich drucke alle Unterlagen zu diesem Projekt aus, das uns stark beschäftigen wird – 27 Seiten Guideline, 44 Seiten Antrag und einige Annexe – Bürokraten-Englisch. Ich fange an zu lesen. Nebenbei – ist mir nicht abwechslungsreich genug – Mail-Check auf Outlook (intern) und Googlemail. Alle Aufgaben, die mir hier zufallen, trage ich ab nun in das blaue Goethe-Institut-Notizheft, das ich vom Partnertag auf dem Vorbereitungsseminar mitgenommen habe, ein – mit jenem grünen Goethe-Kuli aus derselben Quelle, den hier jeder besitzt (und benutzt). Irgendwann wird es mir zu viel und ich gehe eine halbe Stunde auf den Basar, um zu Mittag zu essen – alleine diesmal, zum „Tartaren“. „Wahrscheinlich hat der Laden hier irgendwann mal einem Tartaren gehört.“ Der „Tartar“ ist eine spontane Küche mit einigen Tischen, die einiges anbietet – zur Sicherheit nehme ich, wie gestern, Bortschtsch und Brot für 5000 Sum. Lagman, eine typisch usbekische Suppe mit Fleisch, Gemüse und dicken Nudeln, ist hier sehr gut – und ebenfalls günstig. Etwa Zehn vor Vier bin ich wieder am Platz und lese bis um Fünf die vertrackten Guidelines. Man muss halt manchmal erst dahinter kommen, was gemeint ist und denkt sich, das hätte man auch kürzer halten können. Ich hätte z.B. gerne gewusst, warum ausgeführt wird, wie man eine doppelte Sendung, also zwei Anträge vom selben Antragsteller, im Unterschied zu einem, abschickt, wenn zu Beginn ganz klar und ohne Aber gesagt wird, dass ein Antragsteller in keinem Fall mehr als einen Antrag stellen kann. Da wundert man sich. Im Anschluss blättere ich den Antrag durch und lese das Allgemeine, stelle die Relevanz der relevanten Passagen fest und spreche mit der Institutsleiterin ab, was ich am Freitag zu tun haben werde – nicht das im Übrigen, was ich dann tatsächlich gemacht habe.
Es ist Viertel vor Sechs und ich verlasse das Institut in die abendliche Stadtluft – vielleicht ist gleich Sonnenuntergang, der passiert bereits hier ziemlich schnell – obwohl Taschkent auf der Höhe von Neapel liegt, oder Istanbul. Doch mein Weg führt mich nicht direkt nach Hause, ich gehe noch auf den Basar – bis Dämmerung stehen viele der Händler noch dort. Alles, was ich will, ist eine Lepjoschka, ein Rundbrot, zum ersten Mal direkt aus der Quelle – zuvor nur aus dem Supermarkt, in Plastik verpackt, aus Angst vor den Keimen und Durchfall, Schmerzen… Trotzdem spaziere ich durch die Reihen und schaue mir an die Angebote an – das war, entgegen der Chronologie der Beiträge, bevor ich auch den Chorsu kennengelernt habe.
Mit dem Brot verlasse ich den Basar in Richtung Metro, das erste Mal. Die übliche Taschenkontrolle, noch bevor ich die Unterführung betreten darf, 1000 Sum wortlos gegen einen dieser Plastikchips, und ich gehe in die Station, finde die rechte Richtung und so gut wie wartezeitlos kommt eine Bahn. Zwei Haltestellen, dann steige ich aus – gehe die Treppen nach oben, durch an Burgen erinnernde Gänge (nur ohne Ritterrüstungen und Teppichen an den Wänden) und bin natürlich am Ende auf der falschen Seite der Kreuzung. Noch einmal runter, an einem Polizisten vorbei, der mich bei vormaligem Passieren wegen meines Bartes angesprochen hatte – wo ich wohne, was ich mache, ob ich ja kein – das sagte er nicht – Terrorist sei (auch hier der Freispruch, Deutsch zu sein) – und schließlich am richtigen Ausgang raus, den Weg nach Hause, nicht weit.
Manchmal fahre ich mit dem Bus bis zum Supermarkt, der zufällig günstig und in Laufnähe zur Wohnung ist – das sind im Übrigen beide Supermärkte, die der deutsche Reiseführer in Taschkent nennen kann – und habe, als ich einmal von dort einen alternativen Weg, durch interessante Wohnviertel genommen habe, folgenden Absatz geschrieben, der sehr charakteristisch ist für die Art und Weise, wie ich vieles hier empfange, empfinde, wie ich die Eindrücke unmittelbar spüre (Achtung, Stilwechsel):
Die Szenarien, die meine Augen einfangen, empfangen, begierig, verwirrt aber gefesselt aufnehmen, sind oft stark – so stark, dass ich mich nicht traue, sie zu fotografieren, aus Angst ihnen den Glanz zu nehmen, diese fragilen Bilder mit meiner unbeholfenen Technik zu zerstören – wechselnd erinnern sie mich mal an US-amerikanischen Midwest-Charme, mal an jene mediterranen Städtchen der Sorrentiner Halbinsel, mal sieht alles sehr arabisch aus, obwohl ich dort nicht war – und dann der unübersehbar russische Einfluss, sowie die eigene, folkloristisch usbekische „Tradition“… Aber diese weiten Straßen, innerstädtisch achtspurig, Glasfassaden, oberirdische Stromleitungen queren ausbesserungsbedürftige Straßen, chique gesicherte Neubauvillen face to face zu fünfstöckigen, außen unrenovierten Plattenbauten – das könnte Amerika sein. Dann diese kleinen Anzeichen südländischer Pflanzen überall, das Chaos auf den Straßen, die dicht-an-dicht Läden, das ewig sonnig immer noch heiße Wetter, die Abgase, Autos aller couleur, mit ihren abgewirtschafteten Wohnblöcken, dem maroden Charme der Altbausubstanz – das könnte Sorrent sein. Ohne Wasser, ein entscheidender Unterschied. Doch dann betritt man den Amir-Temur-Platz im Zentrum der Neustadt und denkt sich, so kitschig, riesig, leer – das muss etwas Eigenes sein. Die Mischung zwischen neuosbekischer und sowjetischer Architektur ist eigentlich beißend fürs Auge. Es nicht vielleicht nicht schön, es ist ganz sicher kein Sorrent (der Vergleich hat mich selbst etwas erschreckt), aber diese Spannung, überall greifbar, eben offen sichtbar, die fasziniert mich zu Tode. Sie erweckt Leben und lässt Gegensätze so akut dramatisch, so plakativ, klar sichtbar werden, dass einem der Atem stockt – auch das erinnert mich an die andere Seite des Atlantiks, der hier so fern ist…
Achja, die Stadt – und abends, das Schöne an ihr, so viel – ich hätte Lust, hinauszugehen in die warme Luft zu lachen, genießen – aber die Müdigkeit, sie hält mich hier in diesem grünen Zimmer und hier bleibe ich, hier ist es warm. Nur der Rücken mag das Bett nicht – muss schon damit klar kommen. Sonst schläft er alleine auf dem Boden. Genug Platz für alle Körperteile, die nicht mitkommen wollen. Ich bin wieder zurück in meinem Zimmer, zurück von den Ausflügen in die letzte Woche und all den Wirrungen, Irrungen im Kopf, von den sprunghaften Erinnerungen, sie lebendig zu halten; Hauptsache auf dem Papier… Lange dauert es nicht mehr, lange kann ich nicht mehr, bald ist es fertig, wenigstens dieses, in aller fragmentarischen Beliebigkeit, allen Unterbrechungen und abruptem Schwingen in die nächste Ecke, wohin Gedanken lenken…
Es ist eben nicht möglich, so den Bogen spannend, die Reflexion über das eigene Treiben konstant aufrecht zu halten – man wird verrückt; muss sich auch mal erlauben, unordentlich zu sein, die Struktur zu verlieren oder das Ziel – kann nicht ewig Literatur produzieren; sind meine Finger aus Gold? Andererseits darf das Streben danach, Pathetik, Wahrheit, Verbundenheit, nicht aus dem Auge verloren werden. Wenn man sich aus Angst, sich zu überfordern, gar nicht mehr fordert, dann rinnt das letzte Flüsslein Blut in die Leere und der Kopf sinkt immer tiefer. Wenn man an einem bestimmten Punkt nur sagen kann: Die Arbeit macht mir Spaß… Die Leute sind nett… Und ich fühle mich wohl… Dann hat das Bewusstsein versagt – es finden sich immer Probleme, immer Stellen, an denen zu rühren ist, man kratzen kann, sie aufzuspüren allerdings braucht nichts mehr als Bewusstsein, wache Nerven. Mit der Aufmerksamkeit in Zusammenhang mit dem Bedürfnis nach Schlaf sinkt die Energie, die Kontrolle schaltet sich aus und irgendwann ist der Atem das einzige Lebenszeichen. Ich falle am Abend vor Müdigkeit um und gehe doch nicht ins Bett – denn eigentlich muss ich noch oder sollte, fühle mich verpflichtet zu und würde gerne noch – es bleibt die Pflicht und nichts vom Schönen passiert, lässt sich passieren, wenn ich unruhig warte, während ich nur müde bin – zu müde, um es wahrzunehmen, das Schöne nun. Vielleicht sollte ich heute damit anfangen, mir klar zu machen, dass ich nicht zu warten brauche: darauf, dass ich etwas beginne, gleich unter die Decke und Schluss. Nun schreibe ich und habe wieder eine Ausrede – und ihr müsst das alles lesen, mein Gott… Hoffentlich sind eure Augen offener als meine… Vielleicht beschließt es ganz gut diesen Beitrag, wenn im letzten Atemzug, der letzten Fingerbewegung, die immer langsamer vorangeht als die vorige, wenn mit den letzten Zeichen, die vor meiner Netzhaut flackern, huschen, die Wände und Stühle hochgleiten, verschwinden, mit dem letzten Wandern des blauen Auges, nach oben, auch auf dem Papier der Vorhang fällt, die Schwärze bleibt: doch mit der Gewissheit aufzuwachen, wiederzukehren: in eine anderen Zeit, gereinigt, freier – was für ein Traum!